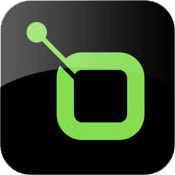Projekt bietet Wege aus der Notunterkunft und wird von Diakonie, Caritas und VGs betreut.
Westerwaldkreis. Das Haus ist eine Kulisse der Trostlosigkeit. Auf der Terrasse steht ein altes Sofa neben notdürftig geflickten Gartengeräten. Kabel hängen wirr von den Wänden, und im Innern hat eine kleine Glühbirne keine Chance gegen düstere Decken und enge Flure. Die Menschen, die hier leben, wollen sich’s trotzdem schön machen. Mit einem Lampion am Fenster, einem Kunstdruck an der Wand. Kleine Lichtblicke in einem Alltag, der für die meisten Bewohner der Notunterkünfte des Westerwaldkreises ziemlich dunkel ist. Diese Notfall-Behausungen bieten Menschen ein Dach über dem Kopf, bevor sie auf der Straße landen. Einer von ihnen steht unter dem Lampion und zieht an seiner Selbstgedrehten.
Der Mann, nennen wir ihn Jakob, ist einer von 15 Männern, die hier leben. „Manchmal bin ich richtig dankbar, dass ich eine Bleibe habe. Denn ohne sie wäre ich obdachlos“, sagt er leise. „Und manchmal ist es die Hölle auf Erden. Je nachdem, mit wem ich mir das Zimmer teile.“ Seit einem Jahr ist Jakob hier. Gewöhnt hat er sich an dieses Leben bis heute nicht. „Andere können das vielleicht. Ich nicht.“ Vielleicht muss er das auch gar nicht. Denn bald hat Jakob eine eigene, eine richtige Wohnung. Jakob nimmt am Landesprojekt „Housing First“ teil. Das Programm richtet sich an Menschen, die schon seit einiger Zeit obdach- oder wohnungslos sind. Im Westerwaldkreis nehmen sechs von zehn Verbandsgemeinden an Housing First teil. Im nördlichen Kreis kümmert sich das Diakonische Werk um das Projekt, im südlichen die Caritas. Die Idee dahinter: Ein vernünftiges Wohnumfeld ist der wichtigste Ausgangspunkt für ein besseres Leben.
Ein besseres Leben. Davon träumen Jakob und seine Mitbewohner. Denn die Notunterkunft ist das, was sie ist: eine Notlösung. Hier kommen Menschen hin, die sich beim Ordnungsamt wohnungslos melden. Das Amt ist dann verpflichtet, sie unterzubringen – falls sie das möchten. „In den größeren Städten gibt es für diese Menschen Schlafstätten“, sagt Thomas Jung von der Verbandsgemeinde Westerburg und einer der Koordinatoren von „Housing First“. „In ländlichen Gebieten haben wir solche Notunterkünfte. Manche wollen dort aber nicht wohnen und entscheiden sich für ein Leben im Zelt oder bei Bekannten auf dem Sofa.“
In jeder Verbandsgemeinde gibt es mindestens eine Notunterkunft. In der Regel sind sie vollbelegt. Viele wissen, wo diese Häuser sind. Leider auch mögliche Arbeitgeber: „Wenn die Menschen, die hier leben, Bewerbungen losschicken, können sie noch so gut für den Job geeignet sein. Sobald der Personalchef die Adresse liest und kennt, hat sich die Sache meistens erledigt“, sagt Nadine Kröller von der Regionalen Diakonie Westerwald, die das Housing-first-Programm im nördlichen Westerwald betreut. Wohnungslos zu sein und in einer Notunterkunft zu leben ist ein Stigma. „Ich kenne einige der Betroffenen seit Jahrzehnten. Sie stecken in einem Teufelskreis, aus dem sie mit eigener Kraft kaum ausbrechen können“, sagt Thomas Jung. „Denn keine Wohnung bedeutet: kein Job, keine Beziehungen, keine Stabilität. Und wenn sie sich eine eigene Wohnung suchen, müssen sie Hürden überwinden: Sie müssen sich an Regeln halten und bestimmte Anforderungen erfüllen – zum Bespiel clean sein. Das schaffen viele nicht.“
Housing First versucht, den Kreis zu durchbrechen: „Das Programm stellt keine Ansprüche an die Betroffenen. Sie bekommen zuerst eine Wohnung und haben dann aus dieser Stabilität heraus die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Der Wohnraum ist ein ausschlaggebender Punkt, um Menschen wieder auf die Beine zu bekommen“, sagt Nadine Kröller. „Bei den ersten Gehversuchen in der neuen Bleibe stehen wir den Menschen zur Seite. Wir schauen einmal pro Woche nach dem Rechten. Manche sind zum Beispiel nicht in der Lage, aus Angst vor der nächsten Mahnung die Post zu öffnen. Dann machen wir das mit ihnen zusammen. Oder wir gehen gemeinsam einkaufen und zeigen ihnen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen. Menschen brauchen eben Perspektiven. Housing First eröffnet sie ihnen.“
Oft hilft das, aber nicht immer. „Manche kommen mit der neuen Situation nicht zurecht und nehmen ihre eigene Wohnung nicht an“, sagt Nadine Kröller. Die meisten aber schon. Und viele blühen richtig auf, beobachtet sie: „Menschen, die vorher im sprichwörtlichen Dreck gelebt haben, machen sich’s plötzlich in ihren eigenen vier Wänden richtig schön und tanken wieder neuen Mut.“
Seit einem Jahr gibt es das Housing-first-Projekt im Westerwaldkreis. Der Anfang ist vielversprechend, findet Nadine Kröller: „Housing First gibt eine neue Stabilität. Die Stigmatisierung durch die Adresse fällt weg. Die Menschen nehmen am gesellschaftlichen Leben teil und besuchen zum Beispiel wieder Volksfeste. Und sie können selbstbewusst ihre Adresse sagen, ohne sich schämen zu müssen.“
Zurzeit gibt es zwölf Housing-First-Plätze im Westerwaldkreis – bei rund 150 Anfragen. Der Bedarf nach neuem Wohnraum ist also groß. Für diejenigen, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen möchten, ist das ein ganz normales Mietverhältnis: „Die Vermieter der Häuser werden in der Regel direkt von der Verbandsgemeinde angefragt: Die VG sucht Wohnungen, die in das Schema des Jobcenters passen, also nicht mehr als 512 Euro an Warmmiete pro Person kosten“, sagt Nadine Kröller. „Das erste halbe Jahr kann die Wohnung über die Verbandsgemeinde angemietet werden und der Bewohner, die Bewohnerin schließt einen Untermietervertrag ab. Erst danach gehen die Rechte und Pflichten auf ihn oder sie über. Die Mitarbeiter des Housing-first-Teams sind für die Klienten aber immer ansprechbar.“
Für Menschen wie Jakob könnte Housing First also wirklich ein Neuanfang sein. Zurzeit wird seine künftige Wohnung noch auf Vordermann gebracht; im Spätsommer kann er einziehen und die Notunterkunft hinter sich lassen. Eigentlich eine gute Nachricht, oder? Jakob drückt seine Kippe im gut gefüllten Ascher vor sich aus. Dann geht er zurück in den Flur. Eine Antwort gibt er nicht. (bon) (Quelle Evang. Dekanat WW)